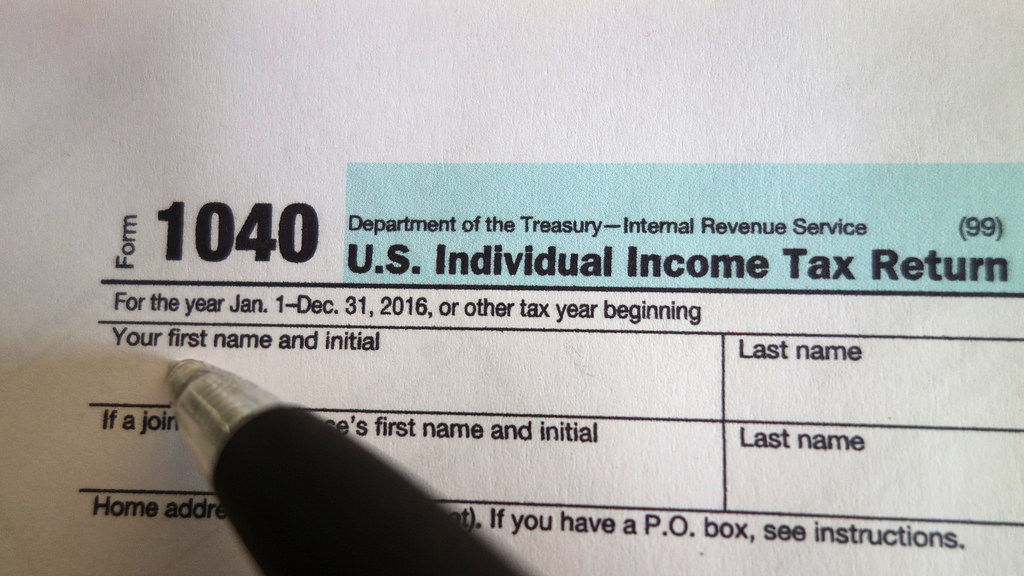Tagebuch aus Deutschland (5): Bücher für den Donbass
Zwischen der Wahrnehmung einer Kriegsgesellschaft und den vom Frieden verwöhnten Teilen Europas liegen Welten. Wie sehr hierzulande noch mit Nebelkerzen geworfen wird, zeigt der Vergleich zwischen den Bedingungen des Kulturbetriebs in Osteuropa und dem deutlichen Wunsch der hiesigen Debatte, „Frieden“ irgendwie herbeizureden.
Teil 5 des Tagebuchs von Marcus Welsch.
Die Illusion, man könne mit jemandem, der einen zerstören will, einen freien Diskurs führen, hält sich in Deutschland länger als gedacht – und leider auch bei italienischen und französischen Politikern. Mittlerweile gibt es aber eine ganze Reihe von klugen Erwiderungen, wie der Text des Übersetzers und Habermas-Kenners Anatoliy Yermolenko zeigt. Die Pointe: Yermolenko hat Habermas’ Theorien als einer der ersten in der Sowjetunion bekannt gemacht und ist der Überzeugung, dass diese den Aufbau einer politischen Nation mit starker Zivilgesellschaft unterstützt haben. Vielleicht müssen sich die Vertreter der Frankfurter Schule doch noch einmal Gedanken darüber machen, warum sie jahrelang Geschichte und Gesellschaft in Osteuropa ignoriert haben. Was nützt die schönste Überlegung, wenn am Ende der Geltungsanspruch der Theorie des kommunikativen Handelns auf ein paar Oasen gelingender Demokratie zusammenschmilzt?
Immer noch die alten Fehler
Aber auch ohne den Disput um den Habermas-Text häufen sich die alten Selbsttäuschungen. Die Illusionen dieser Tage, dass mit etwas gutem Willen und Dialog das Problem Krieg aus der Welt zu schaffen sei, wird dann gefährlich, wenn sich die Trivialisierung des Konflikts mit alten Dogmen mischt. Die „Sünden des Westens“ und eine ganze Reihe von unrealistischen Annahmen wurden jüngst von Klaus von Dohnanyi bemüht und von Andreas Wittkowsky mustergültig zerpflückt. Fällt einem in den TV-Redaktionen wirklich keine bessere Debatte ein, und begeht man erneut die alten Fehler, irgendwie einen Debatten-Zirkus zu befeuern und als Moderatorin überfordert zu sein?
Während hierzulande in den Talkshows erneut über die Köpfe der Betroffenen zu Russlands Verhandlungsbereitschaft und die Unterwerfung besetzter Gebiete spekuliert wird, werden in den ehemaligen Sowjetrepubliken neue Fakten geschaffen; auch im Kulturbereich. In Belarus wurde die jüngste Übersetzung von Orwells Klassiker „1984“ verboten und der Verleger verhaftet. 2020 war diese Neuerscheinung noch ein Renner gewesen.
Harry Potter gegen Lukaschenko
Die Verhaftung des Verlegers ist allerdings nur die Spitze des Eisberges, wie Felix Ackermann in der FAZ kürzlich erläuterte. Mit Extremismuserlassen werde eine ganze Reihe von Verlegern, Autoren und Buchhändler in Belarus kriminalisiert. Dasselbe droht auch den Lesern – doch diese lassen sich nicht so einfach einschüchtern. Als dem Verleger Andrej Januschkiewitsch seine Räumlichkeiten gekündigt wurden, gab es lange Schlangen vor seinem Laden. Man wollte retten, was zu retten ist. In Belarus zeigen sich alle Absurditäten eines paranoiden Staatswesens. Januschkiewitsch Verlag vertrieb auch Bestsellerautoren wie Joanne Rowling. Ihre Bücher wurden im September 2020 vom Zoll beschlagnahmt und erst freigegeben, als der Verleger eine Bestätigung unterschrieb, dass in den Harry-Potter-Büchern nicht „zur Überwindung der heutigen Macht in Belarus“ aufgerufen wurde.
Vergangene Woche berichtete mir ein befreundeter Buchhändler in Berlin von einem Kunden aus St. Petersburg, der sich im Laden beschwert habe, dass man jetzt so umständlich über Tallinn nach Berlin reisen müsse (ja, diese Zeiten…!), um die Bücher zu besorgen, die man in Russland nicht bekommt. Sehr gelassen hat der Reisende darauf hingewiesen, dass man doch in Deutschland endlich einsehen müsse, dass die Welt aus Imperien bestünde und Russland einfach einen Sicherheitskorridor brauche, so wie alle Imperien. Man möchte ihn am liebsten direkt zu Herfried Münkler schicken, der in seinen Gedanken ebenfalls um Imperien kreist und seit Jahren die Sicherheitsansprüche der Ukraine gegen die vermeintlichen Interessen Deutschlands ausspielt. Die Sehnsucht nach Imperien ist ein spezielles Phänomen – sie gedeihen besser, als ich es je für möglich gehalten habe.
Dringend benötigt: Bücher
In der Ukraine haben Bücher indes noch einen anderen Stellenwert. Kürzlich schrieb der Schriftsteller Serhij Zhadan über seinen Besuch in Barwinkowe, einen Ort unweit der mittlerweile am stärksten umkämpften Gebiete in der Ostukraine. Vor dem Krieg haben hier vermutlich 8000 Menschen gelebt. Die russische Artillerie traf dort unter anderem auch die Bibliothek, die daraufhin abbrannte. Zhadan, der wie kein anderer die Städte und kleineren Orte seines Landes aus unzähligen Lesungen und Auftritten kennt, fragt wie immer bei seinen Fahrten durch die östlichen Oblaste, was denn die Leute so bräuchten; was man für sie besorgen könne. Die Antwort war einfach: Bücher. Da waren sie an der richtigen Adresse: Mit seinen Freunden hatte der Schriftsteller in den letzten Jahren des Krieges immer wieder die Bibliotheken im Donbass und in Luhansk mit neuen Büchern versorgt. Damit verknüpfte er das Ziel, eine neue ukrainische Kultur aufzubauen, in den abgelegensten Schulen Lesungen zu organisieren und die Musik zurück in die Region des Kriegs zu bringen. In vielen Kleinstädten dieser Gegend gehen die letzten Neuanschaffungen so mancher Bibliothek auf die Neunzigerjahre zurück. Da der Staat nicht genügend Mittel bereitstellte, organisierten Zhadan und seine Freunde mit Hilfe der größten Verlage den Kulturtransfer auf privatem Wege. Zusammengekommen sind mehrere LKW-Ladungen aktueller Bücher, die er über die Jahre in den Kultureinrichtungen des Donbass verteilte. Wer diese Auftritte, die immer mit Konzerten und Lesungen verbunden waren, einmal miterleben durft, weiß um die Kraft dieser neuen Bewegung in der Ukraine.
2016 war Zhadan auch in Mariupol. Das Interesse war überwältigend. Ich erinnere mich noch an eine Pressekonferenz, bei der die ganze Breite der Gesellschaft sich für diese Privatinitiative interessierte. Von postsowjetischen Lesezirkeln mit Durchschnittsalter 70 bis hin zur jüngsten Aktivistinnen-Szene, die gerade in Mariupol sehr lebendig war, wollten alle der Erneuerung der ukrainischen Literatur im Donbass direkt beiwohnen. Die neu gegründeten Kulturzentren und Cafés waren zu den Lesungen brechend voll. Bis unters Dach drängte sich das Publikum in Mariupol in jenem Kultur-Café, unweit des jetzt zerstörten Theaters, und hing an den Lippen der Autoren aus Kyiw, Kharkiw, Lwiw und den Regionen des Donbass, die bereits 2014 alles verloren hatten. Selten war die Bedeutung von Kultur greifbarer – aber auch umkämpft. Überfälle auf diese neuen Kultureinrichtungen gehörten genauso zu dem Loslösungs- und Umwälzungsprozess vom postsowjetischen Erbe wie der Generationskonflikt zwischen den Jungen, die vehement für eine neue ukrainische Kultur eintraten, und den Älteren, deren Alltag durch das Dreischichtsystem der Stahlwerke geprägt war. Einer der letzten Sowjetfilme „Kleine Vera“, der 1988 in Schdanow, dem heutigen Mariupol, gedreht wurde, zeugt von diesem Konflikt. Gut ist es, wenn dieser Prozess zivil ausgetragen werden kann, wie das Mariupol in den letzten acht Jahren mit seinen vielen Kulturveranstaltungen, Musik-Workshops und feministischen Umzügen sowie den legendären Konzerten am Strand längst bewiesen hatte.
Realer Heldenmut statt Phrasen in Talkshows
Und heute? Zum Zustand der Städte in diesem Krieg fehlen die Worte. Wer den Beiträgen der Ukrainerin Diana Berg in den letzten Wochen folgt, die wie kaum eine andere diese lebendige Kulturszene befeuert hatte, ahnt, was hier verloren ging. Diesen Leuten muss jetzt unsere Unterstützung gelten, ihren Ideen und ihren Aufrufen. Sie sind das Maß der Dinge, sie und nicht irgendwelche Soziologieprofessoren, die den Überlebenskampf anderer Menschen erneut in Talkshows diskreditieren. Nicht zu reden noch von dem Heldenmut wie etwa von Oleksandr Sosnovskyi, der die letzten Wochen – auf eigene Faust – unentwegt Menschen in Kleinbussen aus der Stadt gefahren hat, der an unzähligen russischen Checkpoints um sein Leben fürchten musste und ständig die Gefangennahme riskierte. Alle diese Menschen verdienen allergrößten Respekt.
Zurück in Kharkiw. Nach dem Besuch in Barwinkowe war Zhadan bei seinem alten Verlagshaus Folio in Kharkiw, um die Bitte nach Büchern für die zerstörten Bibliotheken im Donbass weiter zu geben. Im Folio-Verlag sind vor allem die frühen Kult-Bücher des Autors erschienen: Mit Bücher wie „Big Mac“ oder „Depeche Mode“ hat Zhadan eine ganze Generation mit seiner unverblümten Sprache und unangepassten Beobachtungen in Atem gehalten; und er hat nebenbei den sozial Abgehängten ein literarisches Denkmal geschaffen. Im Verlag hat man bereits die Bücherkartons gepackt, die nach dem Krieg in die Bibliotheken kommen: 2000 Bücher, meist Belletristik und historische Literatur, stehen bereit. Es geht um die Planung für ein Leben nach dem Krieg. Und wie eine kluge Beobachterin bemerkte: Es werden immer mehr Bilder in den sozialen Medien mit einem (freien) Himmel gepostet. Auch das darf man als Statement deuten.
Ein Sieg aus der Tradition von Widerstand
Der Optimismus der Kharkiwer Freunde ist ungebrochen . Dass sie siegen werden, ist eine selbstverständliche Formulierung. Eine Formulierung, die hierzulande nicht gerne ausgesprochen wird – anders in den Ländern, die näher an der Ukraine liegen. In dieser Haltung kommt die unterschiedliche Erfahrung von Fremdherrschaft zum Ausdruck, die in der selbstbezüglichen Erfahrungswelt (typisch: meine Familie und die Nationalsozialisten) so mancher deutscher „Intellektuellen“ keine Rolle spielt.
In Polen, wo man neben den Belarusen am meisten mit den Ukrainern mitfiebert, wird auch anders über die Schriftsteller im Krieg geschrieben. Das hat mit der Tradition des polnischen Wiederstandes, aber auch einer anderen Tradition der Reportage zu tun und mit so wohltuenden schrägen Vögeln wie Ziemowit Szczerek, der den Donbass wie seine Westentasche kennt. Man kennt nicht nur das Terrain besser, es geht auch um die Tradition der Literatur selbst. Kürzlich hat Wojciech Orliński, polnischer Journalist und Biograf von Stanisław Lem seine Begeisterung für die Prosa Zhadans erneuert. Bei Zhadan, so Orliński, könnte man die Ausgangslage der Romane wie folgt umreißen: Hauptsache, der Held hat keine Chance. Er schlägt den Bogen zur russischen Literatur, in der die Rebellion gegen Gott, die Herren oder Zaren meist zur Unterwerfung führe – mit oder ohne Einsicht in die „gerechte“ Strafe. Bei der ukrainischen Literatur verhalte es sich anders. Dort wird vermittelt, dass es sich lohne, bis zum Ende zu kämpfen: Denn vielleicht geschieht ja doch noch ein Wunder. Das fasziniert, und zwar nicht nur in Polen.
Ist Literatur überhaupt noch möglich?
Die Kriegs-Realität der letzen Monate verbietet eigentlich jeden Vergleich. Wer wochenlang in Metroschächten ausgeharrt hat, wer ansehen muss, wie Ärzte um das Überleben von Nachbarn und Freunden kämpfen, der braucht einen anderen Überlebensmodus. Wenn ein Krankenhaus nach dem anderen in Mariupol aufgeben werden musste, wenn Jugendliche sich in der Metro Kharkiws um obdachlos gewordene Kinder kümmern, was bedeutet das? Die unzähligen Raketenangriffe sind eine Realität. Aber wenn man dann versucht, alte Leute oder Kranke zu versorgen oder aus der Stadt zu schaffen, dann übersteigt das die Vorstellung zivilen Engagements. Genau das tun aber die Literaten und Musiker, die dort geblieben sind. Dadurch scheint etwas zu entstehen, was über die Wahrnehmung des Einzelnen hinausgeht. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das wohl nicht so einfach zu beschreiben ist. Man bleibt in der Stadt, weil man Kharkiwer ist, sagen sie. Nicht, um darüber zu schreiben. Und was bleibt, wie die Freunde aus Mariupol schreiben, dass ihnen jeden morgen beim Aufwachen die Frage durch den Kopf hämmert, warum haben sie unsere Stadt zerstört!? Ist dann Literatur überhaupt noch möglich?
Ein Buch drängt sich auf, wenn man nach dem Überlebenswillen oder einen Vergleich für diesen mutigen Kampf gegen die Barbarei sucht. Der bahnbrechende Bericht von Miron Białoszewski über den Warschauer Aufstand im Sommer 1944 gehört eigentlich in jeden Geschichtsunterricht. Białoszewski – eine Legende für sich, allein schon wegen seiner Kulturleistungen nach 1945 – bleibt in unserem Gedächtnis ein Unbekannter. Seine Neuauflagen zählt zu denen, die im Lockdown hierzulande komplett untergegangen sind. Dabei gibt die Neuübersetzung von Esther Kinskys erstmals in Deutschland die unzensierte Ausgabe wieder. Was Białoszewski beschreibt, ist ein Leben in einem Belagerungszustand, den man sich als Zivilist nicht vorstellen kann. Und es ist der Stil, der irritiert: Eigentümlich literarisch und wieder nicht, wie man bei der ersten Auflage in Polen von offizieller Seite monierte. Es ist die leidenschaftliche Beschreibung einer Stadt, in der alle wie in einem Mikroorganismus sich gegen den Vernichtungs-Krieg stellen. Beinah traumwandlerisch, das eigentliche Leid außen vor lassend. Białoszewski beschreibt Jahre später seine Erinnerung aus der Perspektive von Jugendlichen, die wie der Autor damals selbst von einem Tag zum anderen die neuen Aufgaben des Überlebens erst verstehen müssen. Nicht nur die Abwesenheit der Brutalität sticht ins Auge – es ist irritierend, dass kein einziger Täter auftaucht. Dabei zählten die Exzesse im Stadtteil Wola zu den schlimmsten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Im Buch kein Deutscher weit und breit. Nur der Horror der ständigen Bombardierung.
Es geschieht erneut
Auch wenn die Niederschlagung des Warschauer Aufstandes für einen Höhepunkt des Vernichtungswillens der NS-Kriegsführung steht, passt etwas nicht mit den Vergleichen zu heute. Die Bilder aus Mariupol wirken anders; direkter, brutaler. Mein Freund Igor, der in diesen Tagen um das Leben seines Vaters bangt, betont, dass sein Vater oft von der Besatzung der Wehrmacht in Mariupol erzählt hat. Sie sei ein Sturm im Wasserglas im Vergleich zu den Ereignissen der letzten Wochen gewesen. Es ist klar, dass man die Situation in Warschau 1944 nicht mit der in Mariupol vergleichen kann. Trotzdem erschrickt man bei der Lektüre Białoszewskis Bericht ständig: Ich hatte für unmöglich gehalten, dass die Vernichtung einer Stadt so noch einmal geschehen könne. Doch genau so ist es gekommen.
Unser Gastkolumnist Marcus Welsch war in den letzten zehn Jahren Dutzende Male in Polen, der Ukraine und anderen Staaten Mittel- und Osteuropa unterwegs. Er ist als Dokumentarfilmregisseur oft mit dem ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan durch den Osten seines Landes gefahren. Warum ihn jetzt das Reden in Deutschland über Krieg und Frieden um den Schlaf bringt, beschreibt er hier in einem mehrteiligen Tagebuch.
Hier geht es zu Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, und Teil 6 des Tagesbuches.