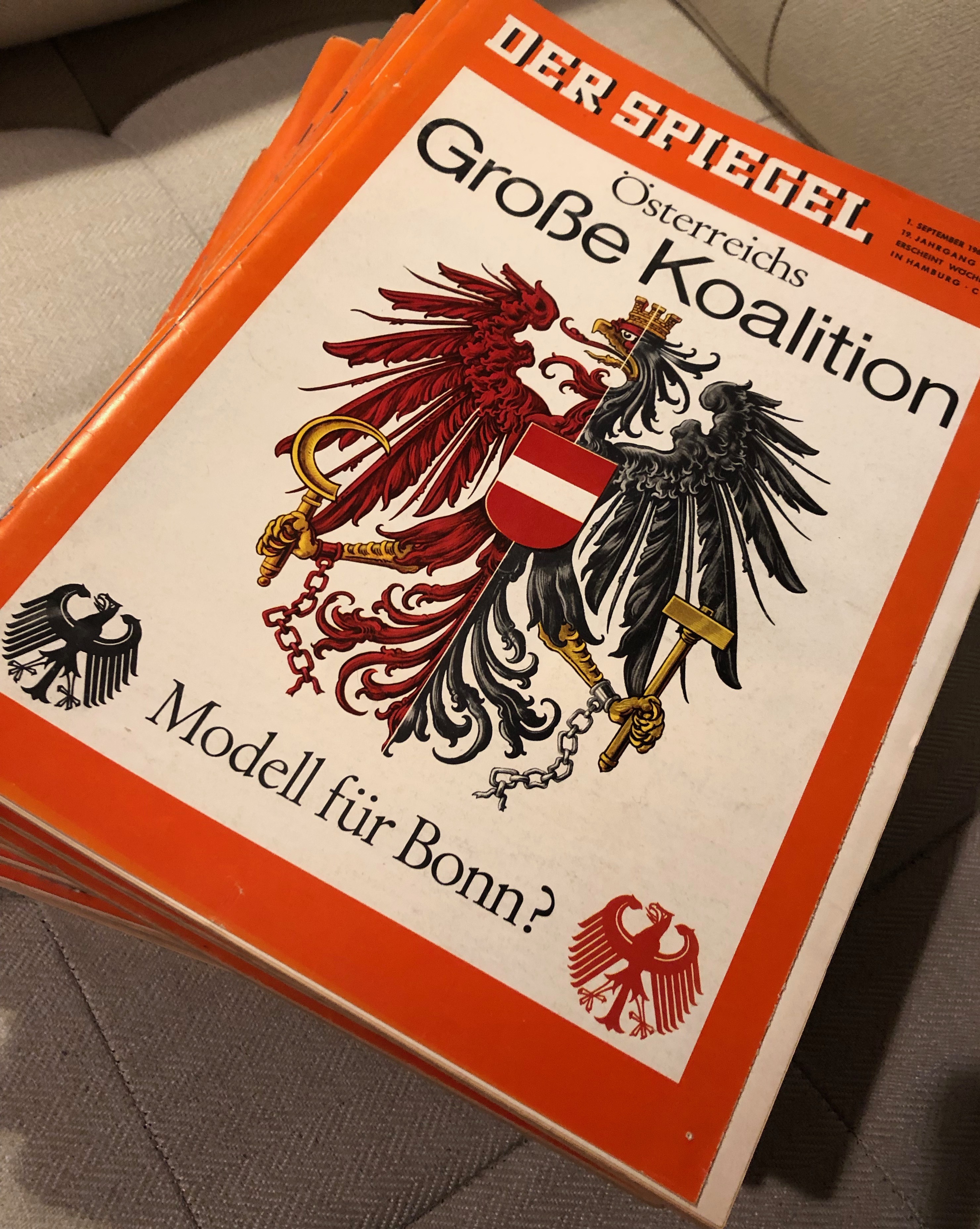Unsere verdammte Unschuld
Der aktuellste Kommentar zu Afghanistan steht in Graham Greenes Roman „Der stille Amerikaner“.
Wenn Besucher kommen – britische Parlamentarier, vielleicht sogar der Premierminister persönlich – dann erklärt Thomas Fowler ihnen die Lage. Fowler ist schon seit Jahren da, Fowler kennt sich aus. Er hat zwar nie die Landessprache gelernt, aber anders als andere Reporter erfindet er seine Geschichten wenigstens nicht: Er reist dorthin, wo die Granaten fliegen, wo es richtig gefährlich ist. Er kennt sich also aus in diesem Krieg, der jetzt schon zehn Jahre dauert und wahrscheinlich nie aufhören wird. „Die Franzosen kontrollieren die Hauptstraßen bis sieben Uhr abends“, sagt Fowler, „danach kontrollieren sie die Wachtürme und die Städte – Teile der Städte. Das bedeutet nicht, dass Sie sicher wären, sonst gäbe es keine Eisengitter vor den Restaurants.“
Thomas Fowler ist nicht echt. Er ist eine Romanfigur in Graham Greenes „Der stille Amerikaner“. Das Tolle und Unglaubliche an diesem Buch – wenn man einmal davon absieht, dass es von dreidimensionalen Romanfiguren bevölkert wird, dass Greenes Sprache so poetisch wie genau ist, dass es sich immer noch sehr frisch liest – also, das Unglaubliche an diesem Buch ist vor allem sein Erscheinungsjahr: 1955.
Es geht in Greenes Roman um einen Konflikt in einem fernen Land. Auf der einen Seite stehen die Verteidiger der Freiheit und des Abendlandes; auf der anderen Seite kämpft ein tückischer und grausamer Feind, den man nie zu Gesicht bekommt. Er kämpft im Schutz der Dunkelheit, er ist überall dort, wo der Lichtkegel der Zivilisation nicht hinfällt. Dann gibt es noch verschiedene Warlords, bewaffnete Verbrecher, die auf eigene Rechnung massakrieren. Ferner existiert noch eine reguläre einheimische Armee, die von den Franzosen unterstützt wird. Dann gibt es die Zivilbevölkerung. Endlich gibt es die Toten, vor allem die toten Kinder – an einer Stelle des Romans wird beschrieben, wie eine Mutter und ihr achtjähriger Sohn niedergemäht werden. Von wem? Ist das wichtig?
Der gefährliche Mangel an Zynismus
Fowler, der Erzähler des Romans, ist Zyniker, also Realist. An verschiedenen Stellen des Romans charakterisiert Greene ihn mit dem Ausdruck „not involved“: Fowler stellt sich auf keine Seite, er weigert sich, Partei zu ergreifen. Er hat keine Illusionen. Er weiß, was kommen wird. „Wir marschieren in ein Land ein; die Stämme vor Ort unterstützen uns; wir siegen …“ Aber man will ja schließlich keine Kolonialmacht sein, nicht wahr? „Oh nein, wir machten Frieden mit dem König und übergaben ihm seine Provinzen und ließen unsere Verbündeten zurück, damit sie gekreuzigt und in zwei Teile zersägt werden konnten. Sie waren unschuldig. Sie dachten, wir würden dableiben. Aber wir waren Liberale und wollten kein schlechtes Gewissen haben.“
Der Gegenspieler von Fowler ist Pyle, ein junger Amerikaner. Im Unterschied zu Fowler ist Pyle kein Zyniker. Er ist Idealist. Er war noch nie in Vietnam, aber er weiß sofort, wie der Konflikt in Vietnam zu lösen wäre, denn er hat die Bücher eines gewissen York Harding gelesen. Vor allem sein Werk „Die Rolle des Westens“. York Harding rät, weder die französische Kolonialmacht noch die Kommunisten zu unterstützen, sondern nach einer „dritten Kraft“ zu suchen, die dann in Asien die Demokratie einführen werde.
Das übliche antiamerikanische Klischee ist, dass es den US-Imperialisten immer um irgendwelche schmutzigen Interessen gehe: um Öl oder um Macht. Dieses antiamerikanische Klischee wird in Greenes Roman nicht bedient. Was Pyle so gefährlich macht, ist gerade sein vollkommener Mangel an Zynismus. Er glaubt an die Güte und Unschuld Amerikas, das – anders als Großbritannien und Frankreich – keine alte Kolonialmacht ist. Er glaubt mit ganzem Herzen an die Demokratie. „Gott schütze uns zu jeder Zeit vor den Unschuldigen und den Guten“, kommentiert Fowler darum spöttisch an einer Stelle. An anderer Stelle heißt es: „Die Unschuld ist wie ein dummer Leprakranker, der seine Glocke verloren hat, auf der ganzen Welt herumwandert und niemandem etwas Böses will.“
Eine der unvergesslichsten Passagen des Buches handelt davon, wie Pyle und Fowler sich in einem jener Wachtürme verstecken, von denen am Anfang die Rede war. Ihnen ist mitten auf der Landstraße das Benzin ausgegangen, ihr Auto bewegt sich keinen Meter weiter, nun fällt Dunkelheit über das Land.
Fowler und Pyle verkriechen sich in den Wachturm zu zwei blutjungen Soldaten. Natürlich werden diese Soldaten in dem Moment davonlaufen, wo der Vietkong (der damals noch „Vietminh“ hieß) den Wachturm angreift. Sie sind ja nicht blöd. „Sogar ganze Battalione haben schon ihre Offiziere ausgeliefert“, erklärt Fowler in der Dunkelheit. „Manchmal haben die Viets mehr Erfolg mit einem Megaphon als mit seiner Bazooka.“ Aber wollen die jungen Soldaten in dem Wachturm nicht die Freiheit? Sind sie nicht gegen den Kommunismus? „Sie wollen genug Reis“, erklärt Fowler. „Sie wollen nicht, dass man auf sie schießt. Sie wollen, dass ein Tag wie der andere aussieht. Sie wollen nicht unsere weißen Häute, die ihnen erzählen, was sie wollen.“ Selbstverständlich kommt es zu einem Angriff. Was dann passiert, wird hier nicht verraten: Das soll jeder und jede selber nachlesen.
Wir haben vergessen
Gegen Ende des Romans begleitet Fowler als „embedded journalist“ einen französischen Piloten bei einem Bombenangriff. Unter anderem feuert der Pilot dabei aus allen Rohren auf flaches Boot in einem Fluss. Befinden sich auf dem Boot kommunistische Guerillakämpfer oder harmlose Zivilisten? Die Order lautet, auf alles zu schießen, was sich bewegt. Hinterher redet der Pilot Klartext, während Fowler Opium raucht. „Du bist Journalist. Du weißt besser als ich, dass wir nicht gewinnen können. Du weißt, dass die Straße nach Hanoi jede Nacht unterbrochen und mit Minen versehen wird. Du weißt, dass wir jedes Jahr eine Klasse von St. Cyr verlieren.“ (St. Cyr ist der Name der französischen Militärakademie – das Pendant zu West Point in Amerika.) „Aber wir sind Berufssoldaten; wir müssen weiterkämpfen, bis die Politiker uns sagen, dass wir aufhören sollen. Wahrscheinlich werden sie zusammenkommen und irgendeinem Frieden zustimmen, den wir schon am Anfang hätten haben können und der all diese Jahre in Unsinn verwandelt.“
Im Kern ist „Der stille Amerikaner“ eine Dreiecksgeschichte: Fowler und Pyle sind in dieselbe schöne Vietnamesin verliebt, eine junge Frau namens Phuong. Phuong ist keine Zynikerin wie Fowler; sie ist auch keine Idealistin wie Pyle. Sie hat nur ein Ziel: Sie will einen Europäer finden, der sie heiratet und aus dem Land bringt, ehe es sich endgültig in eine Hölle verwandelt. Pyle – der wahrscheinlich für die CIA arbeitet – findet unterdessen die „dritte Kraft“, die sowohl gegen die Franzosen als auch gegen die Kommunisten kämpft. Leider löst er, nachdem er jene „dritte Kraft“ gefunden hat, ein Massaker aus. Hinterher verliert er selber sein Leben. Aber wer hat ihn ermordet?
Wir sahen die Bilder aus Kabul, wo Leute, die vor totalitären Schlächtern fliehen, sich verzweifelt an amerikanische Militärmaschinen klammerten und abstürzten wie Ikarus, der zu nahe an die Sonne flog. Viele von uns waren entsetzt. Unser Entsetzen zeigt vor allem eines: unsere extreme Gedächtnisschwäche. Offenbar haben wir vergessen, was passierte, nachdem die Briten sich 1947 aus Indien zurückzogen. Wir haben vergessen, was geschah, nachdem die Franzosen 1962 in Algerien kapitulierten. Wir haben die Bilder aus Saigon vom Jahre 1975 vergessen – wir haben sogar die vietnamesischen „boat people“ vergessen. Wir wissen nicht mehr, was den Christen im Libanon blühte, nachdem Israel im Jahr 2000 die „Sicherheitszone“ im Süden des Landes räumte und die Hisbollah nachrückte. Wir haben unsere Illusionen gepflegt und gehätschelt. Wir haben vergessen, Graham Greenes „Der stille Amerikaner“ zu lesen.
Graham Greene
Der stille Amerikaner.
Aus dem Englischen von Walter Puchwein.
dtv, 240 S.