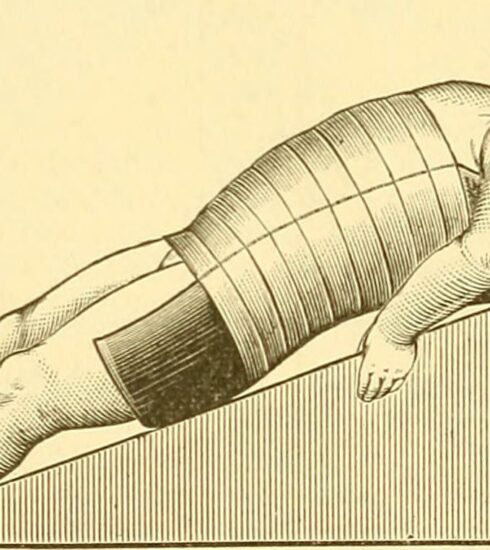Mythenjagd (11): Öko-Landbau ist umweltfreundlich
Weder beim Nitrateintrag ins Grundwasser noch beim Pflanzenschutz gehen die Behauptungen zur vorgeblich ökologischeren Landwirtschaft der Bioverbände auf. Vor allem aber bei der Verteufelung neuer Züchtungsmethoden zeigt sich: Das Bio-Glaubensdogma ist am Ende stärker als das propagierte Ziel des Umweltschutzes.
Der Biolandbau und seine Wahrnehmung in der breiten Bevölkerung sind so sehr von Mythen durchsetzt, dass diese Serie vermutlich noch über Jahre monothematisch fortgesetzt werden könnte. Ein Beispiel ist die immer wieder geäußerte Behauptung, Bio-Bauern würden ihre Felder nicht spritzen.
Selbstverständlich tun sie das, und das führt gleich weiter zum nächsten Mythos: dass „synthetische“ Pflanzenschutzmittel grundsätzlich schlechter seien als „natürliche“. Doch das ist keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern lediglich eine willkürliche und unbelegte Setzung, mithin eine religiöse Überzeugung.
Noch dazu eine, die gelegentlich mit den Fakten kollidiert. So verglichen kanadische Wissenschaftlicher 2010 den Einsatz zweier neuartiger synthetischer Insektizide (Spirotetramat und Flonicamid) mit dem zweier organischer Insektizide (Beauveria bassiana und eine Mineralöl-Emulsion) gegen Sojabohnen-Blattläuse. Das Ergebnis: Die Bio-Mittel waren nicht nur deutlich weniger wirksam gegen die Schädlinge und schadeten insgesamt mehr Organismen als die synthetischen Mittel, sie waren auch giftiger für Piratenwanzen, ein Nützling, der lästige Blattläuse aussaugt.
Alles in allem kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass die synthetischen Insektizide bei Wirksamkeit, Selektivität und generellem Umwelteinfluss (Environmental Impact Quotient EIQ) besser abschneiden als die organischen Mittel. Entsprechend seien die Methoden des ökologischen Landbaus keinesfalls immer nachhaltiger als die konventioneller Landwirte, es stehe aber zu befürchten, dass die Bio-Label „die Technologie mit den geringsten Umweltauswirkungen aus ideologischen Gründen ablehnen werden“.
Bio-Pestizide aus dem Weltall
Diese Ideologie treibt bisweilen absurde Blüten. Als der feuchte Sommer 2016 zu einem massiven Auftreten von Falschem Mehltau in Wein und Kraut- und Knollenfäule bei Kartoffeln führte – der Bundesverband ökologisch arbeitender Weingüter Ecovin sprach von einem „Horrorjahr“ mit sich abzeichnenden Totalausfällen bei der Ernte –, versuchten Bio-Winzer verzweifelt, eine Ausnahmeregelung für das Fungizid Kalium-Phosphonat durchzusetzen, das einige Jahre zuvor von der Liste der zugelassenen Mittel für den Ökolandbau gestrichen worden war. Dabei beriefen sie sich auch auf ein Gutachten, demzufolge die Chemikalie zwar „nicht direkt als natürlich“ bezeichnet werden könne, das aber immerhin einen „naturstofflichen Charakter“ feststellte – unter anderem, weil chemisch ähnliche Verbindungen in Meteoriten nachgewiesen werden konnten (s.a. Zwei-Klassen-Chemie).
Ginge es tatsächlich um eine möglichst umweltverträgliche Landwirtschaft, dann müssten die Bioverbände Anhänger des integrierten Pflanzenschutzes (IPS) sein. Gemäß deutschem Pflanzenschutzgesetz von 2012 ist IPS „eine Kombination von Verfahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung chemischer Maßnahmen auf das notwendige Maß beschränkt wird“.
Seit 2014 ist IPS verbindlicher Grundsatz der Landwirtschaft in der EU. Viele Methoden zur Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln stammen aus dem Biolandbau oder werden dort intensiv angewendet. Unkraut kann mechanisch, also mit dem Pflug statt mit einem Herbizid bekämpft werden. Gegen Blattläuse helfen Marienkäfer, deren Larven sich von den Läusen ernähren. Spätere Aussaat von Wintergetreide kann Pilzbefall verringern. Und über die Fruchtfolge, also den Wechsel der angebauten Pflanzen auf dem Acker, können auf bestimmte Früchte spezialisierte Schädlinge im Zaum gehalten werden. „Chemischer Pflanzenschutz soll vom Betriebsmittel zum Notnagel des Landwirts werden“, fasst Dr. Jan Helbig vom Julius-Kühn-Institut für Kulturpflanzenforschung (JKI) das Ziel des IPS zusammen. Helbig ist Koordinator des Modellprojekts „Demonstrationsbetriebe integrierter Pflanzenschutz“ am JKI.
Integrierter vs. ideologisierter Pflanzenschutz
Ein Beispiel für den pragmatischen Ansatz des IPS ist die Kombination von relativ bodenschonenden Verfahren der mechanischen Unkrautbekämpfung wie Grubbern, Striegeln oder Hacken mit eingeschränktem Herbizid-Einsatz: „In Kombination mit einer sogenannten Bandspritze wird zwischen den Reihen zum Beispiel von Rüben oder Mais Unkraut gehackt und nur in einem schmalen Band neben den Reihen, wo die Hacke nicht hinkommt, gesprüht. So lässt sich die Herbizid-Menge deutlich reduzieren“, erklärt Helbig. Bei einem dreijährigen Test in der Schweiz konnte der Spritzmitteleinsatz mit diesem Verfahren um die Hälfte verringert werden.
Andere Maßnahmen des IPS sind längst Alltagspraxis in landwirtschaftlichen Betrieben. So werden etwa am Rand von Rapsfeldern gelbe Schalen aufgestellt, in denen sich Rapsglanzkäfer niederlassen. So kann der Befall ermittelt und über eine mögliche Bekämpfung entschieden werden. Die ist abhängig von sogenannten Schadschwellen. „Die besagen, dass zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Blattläusen pro Blatt hinnehmbar sind, weil eine Behandlung teurer wäre als die zu erwartenden Ertragseinbußen durch den Schädling“, erläutert Helbig.
Tatsächlich hat sich auf den IPS-Demonstrationsbetrieben gezeigt, dass eine intensivere Beobachtung der Felder mit einer deutlichen Reduktion chemischer Pflanzenschutzanwendungen einhergeht. Ulrich Löhr, Vorsitzender des Landvolks Braunschweiger Land, gesteht ein: „Noch vor zehn Jahren hätten wir nicht geglaubt, dass manche Schädlinge in viel größeren Mengen zu akzeptieren sind.“ Landwirte, die den Zustand ihrer Felder gut kennen, entscheiden sich seltener zum Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel.
Doch im der Bio-Kult sind chemische Mittel nicht nur möglichst zu vermeiden, sondern tabu. Und das hat Folgen: „Langzeitversuche des Julius-Kühn-Instituts zeigen, dass zum Beispiel die Winterweizenerträge im Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2016 ohne chemische Pflanzenschutzmaßnahmen um 31 Prozent niedriger lagen als die mit einer Behandlung“, heißt es in einer Broschüre des JKI zum integrierten Pflanzenschutz. In anderen Kulturen ist der Unterschied zum Teil noch deutlich größer. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ohne chemische Spritzmittel die Ackerfläche um knapp 45 Prozent vergrößert werden müsste, um die gleiche Erntemenge einzufahren (s.a. Schluss mit der Verschwendung!)
Mehr Flächenverbrauch bedeutet weniger Artenvielfalt und mehr Nitrat
Diese mangelnde Effizienz beim Umgang mit der Ressource Boden verhagelt dem Bio-Landbau die Ökobilanz, denn Umweltschutz und Ressourcenverschwendung passen schlecht zusammen. Zwar herrscht auf dem Bio-Acker mehr Artenvielfalt als auf einem konventionell bewirtschafteten Feld, aber auch für Bio-Bauern gilt, dass spätestens am Ende der Prozesskette Artenvielfalt alles andere als erwünscht ist. Im Hirsebrei soll schließlich Hirse sein und keine giftigen Wildkräutersamen.
Darum herrscht auch auf dem Bio-Acker eine um rund 67 Prozent reduzierte Artenvielfalt verglichen mit einem natürlichen Ökosystem. Immerhin, das ist mehr als auf einem konventionell bewirtschafteten Feld, wo die Biodiversität um 86 Prozent reduziert ist. Rechnet man nun aber den geringeren Ertrag pro Fläche mit ein, dann ist bei gleicher Erntemenge der Verlust an Artenvielfalt im Bio-Landbau rund 50 Prozent größer als beim konventionellen Anbau. Denn die durch höhere Erträge eingesparte Fläche kann zumindest theoretisch unberührt bleiben. Angesichts einer weiterhin zunehmenden (in zweierlei Bedeutung) Weltbevölkerung ist diese Tatsache gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern von großer Bedeutung.
Eine schärfere Düngeverordnung könnte auch Bio-Bauern Probleme machen
Ein ähnlicher Effekt zeigt sich beim Düngen. Gerade erst hat der Europäische Gerichtshof einer Klage der EU-Kommission gegen Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser stattgegeben – was in den deutschen Medien mal wieder zu einer Flut von unpassenden Symbolbildern geführt hat, die eine längst verbotene Form der Ausbringung von Gülle zeigen. Auch hier wird häufig auf die Schuld der konventionellen Landwirtschaft mit ihrer „Massentierhaltung“ und ihren Stickstoffüberschüssen verwiesen.

Tatsächlich schneidet der Ökolandbau beim Nitrat besser ab – zumindest auf den ersten Blick. So schreibt der Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft auf seiner Internetseite: „Auf ökologischen Betrieben sind die Stickstoff-Überschüsse meist deutlich geringer als auf konventionellen; bezogen auf die Fläche sind die Sickerraten von Nitrat um bis zu 50 % geringer.“ Um dann aber sogleich einzuräumen: „Pro Tonne produzierten Ertrags sind die Nitratsickerraten allerdings in beiden Wirtschaftssystemen ähnlich einzustufen.“ Sprich: Will man die gleiche Erntemenge einfahren, löst sich der Unterschied in Luft auf. Das ist der gleiche Effekt wie bei der Artenvielfalt: Bio ist nur dann ökologisch, wenn wir deutlich weniger essen. Dafür müsste aber die Weltbevölkerung erheblich reduziert werden. Allerdings hält sich die Bereitschaft zum freiwilligen Abtreten bei den meisten Menschen in Grenzen.
Die neue Düngeverordnung ist gerade mal ein Jahr in Kraft, die erste Ernte noch gar nicht komplett eingefahren, da kommen bereits Forderungen nach einer weiteren Verschärfung auf. Doch das könnte auch Bio-Landwirten Probleme bereiten. Denn die verwenden zum Düngen häufig Komposte, die neben Stickstoff viel Phosphor enthalten. Durch die Deckelung der Phosphormenge durch die Düngeverordnung besteht in einigen Kulturen bereits die Gefahr einer Stickstoffunterversorgung. Wird die Phosphorgrenze weiter gesenkt, könne das bei Kulturen mit hohem Stickstoffbedarf dazu führen, „dass der Stickstoffbedarf der Kulturen dann nicht mehr vollständig gedeckt werden kann“, heißt es auf dem Informationsportal für Ökolandbau der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.
Gentechnik – Das wirksamste Instrument für ökologischen Landbau wird abgelehnt
Den größten Einfluss auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger dürften aber nicht einzelne Maßnahmen wie die Bandspritzung oder die Wahl des Düngemittels haben, sondern die Züchtung neuer Sorten. Jan Helbig sieht dabei enormes Potenzial in den neuen Methoden des Genome Editing wie CRISPR/Cas9. Sie könnten die Züchtung extrem beschleunigen. Dafür brauche es „Mut, in eine fortschrittliche Technik zu investieren.“
Danach sieht es in der EU derzeit allerdings nicht aus. Seit Jahren drücken sich Behörden und Gerichte um die Entscheidung, ob die Methoden nach dem restriktiven Gentechnikgesetz reguliert werden sollen, was die CRISPR-Züchtung in Europa wohl ersticken würde.

Für die Bioverbände ist Gentechnik Teufelszeug. Und obwohl Genome Editing präzise Punktmutationen ermöglicht, die von einer natürlich auftretenden Veränderung nicht zu unterscheiden ist, lehnen sie diese neue Technologie genauso ab wie die Übertragung artfremden Erbguts bei transgenen Pflanzen.
Dabei haben diese einen belegten positiven Umwelteffekt: Sogenannte Bt-Pflanzen haben den Einsatz von Pestiziden um durchschnittlich 37 Prozent reduziert und dabei zugleich die Erträge und das Einkommen der Landwirte erhöht. Und nebenbei sind sie sogar weniger mit Pilzgiften belastet und damit gesünder.
Mit CRISPR/Cas wäre es nun beispielsweise möglich, alte Gene im Erbgut von Pflanzen zu reaktivieren, die Krankheitsresistenzen erzeugen, oder Gene aus wilden Sorten derselben Art, die Stresstoleranz (bei Hitze oder Wassermangel) vermitteln, in Kulturpflanzen zu übertragen. Die Methode ist schnell, effizient und vor allem günstig, was bedeutet, dass das durch die extrem strikte Regulierung der Gentechnik entstandene Oligopol weniger Großkonzerne auf diesem Gebiet gebrochen werden könnte. Besondere Risiken, die über jene der klassischen Züchtung hinausgehen, sind nicht bekannt.
Genome Editing ist die Nagelprobe für den Biolandbau. Ginge es wirklich an erster Stelle um den Schutz der Umwelt, dann müsste eine Methode, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren, Ressourcen schonen und Erträge sichern könnte, begrüßt werden – so wie es der in der Bioszene renommierte Urs Niggli bereits vor Jahren getan hat. Die Bioverbände hingegen beweisen mit ihrer fundamentalen Ablehnung, dass ihnen im Zweifelsfall der Schutz eines gänzlich irrationalen und damit religiösen Dogmas wichtiger ist als der Umweltschutz.
[hr gap=“20″]
Bio bedeutet ungespritzt. Kernreaktoren können explodieren. Kuba hat ein vorbildliches Gesundheitssystem. Der Körper kann entschlackt werden. Die Meere sind überfischt. Wassersparen schont die Umwelt. Tierversuche sind überflüssig. Homöopathie ist keine Magie. Homosexualität ist unnatürlich. Erst stirbt die Biene, dann der Mensch. In unregelmäßigen Abständen begibt sich Johannes Kaufmann hier auf Mythenjagd. Themenvorschläge werden gern entgegengenommen.
Sämtliche Mythenjagd-Beiträge finden sich hier.